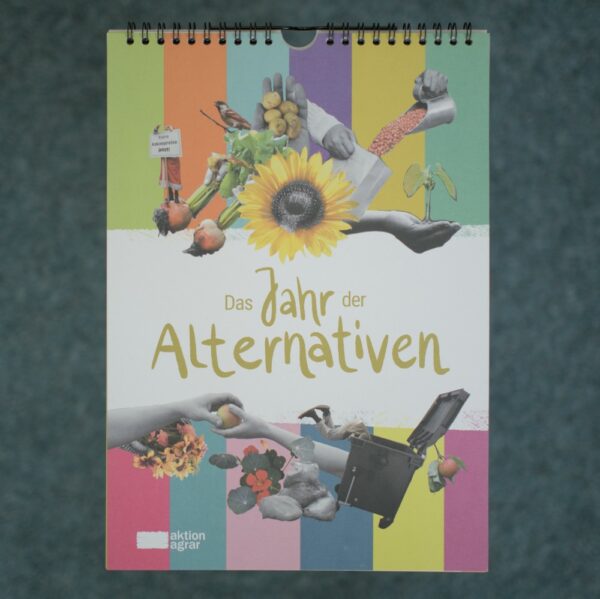Jahr der Alternativen
Zusammenfassung unserer Kampagne von 2018/19
Um keine Neuigkeiten mehr zu verpassen, abonniere den Newsletter.
Regionale Lebensmittel statt Konzernmacht
Wir wollen auch in Zukunft noch gesunde Lebensmittel genießen, das Artensterben stoppen und bäuerliche Landwirtschaft erhalten. Lasst uns deshalb unser Ernährungssystem zurück in die Region(en) holen und den Großkonzernen zwischen Acker und Teller die kalte Schulter zeigen. Mit dem Jahr der Alternativen hat Aktion Agrar von 2018 bis 2019 den vielen Einkaufsalternativen, die es schon gibt, mehr Aufmerksamkeit beschert und Lust gemacht, die großen Supermärkte und Amazon Fresh zu umgehen.
Kalender für konzernfreies Einkaufen
Der kleine Begleiter fürs konzernfreie Einkaufen schlägt dir jeden Monat die Alternative des Monats vor. 2023 haben wir ihn nochmal komplett überarbeitet. Er kommt im DIN A4 Format und enthält keine Wochentage, ist also jedes Jahr wieder einsetzbar – gerne genutzt auch als Geburtstagskalender.
Hier kannst du ihn kostenfrei bestellen:
Hintergrund & Wissenswertes
Wieso brauchen wir regionale Alternativen?
Ländliche und vorstädtische Regionen haben es nicht einfach in diesen Tagen: Global agierende Megakonzerne verdrängen lokale Händler*innen, drücken Preise auf Erzeuger*innen in der Region und vermeiden es mit fiesen Tricks, Steuern an Kommunen zu zahlen. Kleine und mittlere Betriebe müssen Tierfabriken weichen, die Luft und Wasser verschmutzen, und Tiere quälen. Der inhabergeführte Bio-Laden muss schließen, weil der nächste Supermarkt eröffnet, in dem sich das in Plastik verpackte Gemüse aus Almeria aneinander reiht. So geht es nicht weiter. Es ist Zeit, selbst aktiv zu werden. Denn wir können es besser!
Welche Folgen hat unsere „immer verfügbar“-Mentalität für die Umwelt?
Wir gehen in den Supermarkt und sind von einem Überangebot an Nahrungsmitteln umgeben – egal zu welcher Jahreszeit. Doch welche Auswirkungen hat solch eine allzeit gigantische Auswahl auf unsere Umwelt? Um ein ganzjähriges Angebot einer vielfältigsten Lebensmittel-Auswahl garantieren zu können, sind längst nicht nur die an tropische Klimate angepassten Südfrüchte wie Ananas und Avocados um die halbe Welt gereist. Mittlerweile hat die Globalisierung bereits unsere heimische Marktfruchtwirtschaft erreicht. Obst- und Gemüsesorten wie Erdbeeren und Kartoffeln, die an unsere klimatischen Anbaubedingungen gut angepasst sind, werden trotzdem von weit her importiert, um sie auch außerhalb der Saison anbieten zu können.
Welche Emmissionen entstehen durch die Transportwege?
Für den Transport werden große Mengen an klimaschädlichen Gasen ausgestoßen. Wird ein Kilogramm Gemüse per Schiff aus Übersee transportiert, könnten für den gleichen Ausstoß an klimaschädlichen Gasen 11 kg Gemüse innerhalb Deutschlands transportiert werden. Der Transport mit dem Flugzeug stößt sogar fast das 90-Fache an Kohlendioxid und Schwefeldioxid aus als die inländische Gemüseproduktion. Da jedoch vor allem schnell verderbliche Südfrüchte besonders zügig transportiert werden, wird der Transport per Flugzeug häufig genutzt. Verbraucher*innen, die beim Einkauf auf Lebensmittel mit geringen Transportwegen achten, tragen somit zur Reduktion der klimaschädigenden Gase bei.
Welche Auswirkungen hat der Import auf den lokalen Markt?
Da die Lebensmittelerzeugung in Europa aufgrund von höheren Pacht- und Arbeitskosten teurer ist als in vielen anderen Ländern der Welt, unterliegt die heimische Lebensmittelproduktion in vielen Bereichen dem internationalen Marktwettbewerb und wird somit durch den Trend nach billigen Lebensmitteln vom Markt verdrängt. Somit verursacht eine lange Reise dieser Lebensmittel nicht nur einen überflüssigen Schadstoffemissionen durch den Transport, sondern erschwert zudem den regionalen Lebensmittelmarkt.
Wie sind die Bedingungen in den Produktionsländern?
Die auf höchsten Profit ausgerichteten Lebensmittelkonzerne zahlen den Landwirten in den Produktionsländern bei riskanten und gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen lediglich einen geringen Lohn zum Überleben, während die mächtigen Unternehmen weiter expandieren und durch Zusammenschlüsse einzelner Firmen den Lebensmittelmarkt immer stärker kontrollieren. Die europäische Ernährungsindustrie verspricht sich durch den globalen Handel einen gesteigerten Umsatz auf Kosten von Mensch, Tier und Umwelt.
Wie sieht es bei tierischen Produkten aus?
Nicht nur Obst und Gemüse haben meist eine lange Reise hinter sich, auch Milch- und Fleischprodukten aus konventioneller Produktion ist ein enormer Futtermittelimport von Übersee vorangegangen. Um die heimischen Nutztiere aus konventioneller Tierhaltung mit proteinreichem Futter in Form von Sojaschrot zu versorgen, müssen riesige Teile des südamerikanischen Regenwalds weichen, wodurch zahlreiche Tier- und Pflanzenarten verloren gehen.
Erfüllen die Importprodukte unsere Standards?
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat in 6,5% der Lebensmittelimporte aus Nicht-EU-Ländern eine stärkere Pestizidbelastung festgestellt, wodurch der Verbraucher einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt ist. Regionale Lebensmittel enthalten dagegen meist höhere Gehalte an gesundheitsfördernden Substanzen wie sekundäre Pflanzenstoffe. Diese schützen unter anderem das Herz-Kreislauf-System und verfügen über eine krebshemmende Wirkung.
Was kannst du hier entdecken?
Für jeden Monat findest du hier eine saisonale konzernfreie Alternative. Manche davon sind altbewährt, manche ganz neu und digital, aber bei allen steht fest: du weißt wo die Produkte herkommen und wo dein Geld landet. Nämlich in der Nachbarschaft. Außerdem schonen kurze Wege die Umwelt.
Hinzu kommen Veranstaltungsformate, die Du auch selbst mit Freund*innen auf die Beine stellen kannst. Ob Saatguttausch, politisches Marktfrühstück oder Stoppelparty, alles läuft im Sinne des Begegnens, des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen Erzeuger*innen und Kund*innen, zwischen Stadt und Land.
Januar
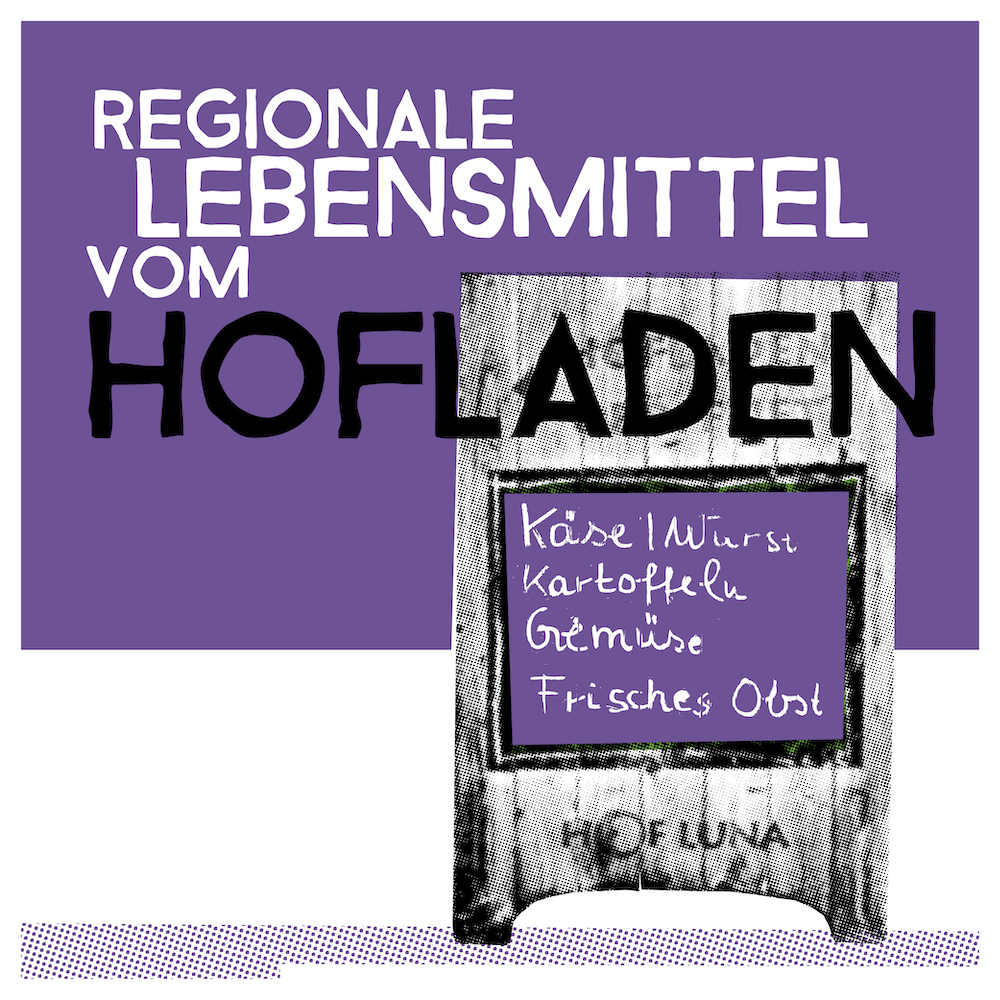
Regionale Lebensmittel aus dem Hofladen
Stammen die Lebensmittel also aus regionaler Erzeugung und Verarbeitung und werden ortsnah vermarktet, kann eine erheblich nachhaltigere Ernährungsweise durchgesetzt werden. Doch wie können Verbraucher*innen auf kurze Transportwege ihrer Lebensmittel achten?
Zunächst sollte auf die heimische Saisonalität der Produkte geachtet werden. Kann ich diese nicht einordnen, verrät die Herkunftskennzeichnung auf der Verpackung das Ursprungsland. Eine noch nachhaltigere Alternative stellen Direktvermarktungen wie örtliche Hofläden da. Denn hierbei fällt der Zwischenhandel weg und der Gewinn bleibt komplett bei den Erzeuger*innen. Somit helfen Hoflöden, Marktstände und Abokisten die Existenz vor allem kleinerer und mittlerer Betriebe zu sichern und die Umwelt zu schützen.
Hier geht’s zum Direktvermarkter in deiner Nähe.
Februar

FoodCoops & Mitgliederläden
Du willst Lebensmittel haben, in guter Qualität, zu niedrigen Preisen und ohne die ganze lästige Plastikverpackung? Dann ist eine Einkaufskooperative oder „FoodCoop“ vielleicht das Richtige für dich.
Bei einer FoodCoop schließen sich Verbraucher*innen zusammen und bestellen direkt beim Großhandel oder Bauernhof im großen Mengen ein. In Gemeinschaft wird abgestimmt, welche waren eingekauft werden, je nachdem auf was die Mitglieder Lust haben oder auf was sie besonderen Wert legen. Es entsteht direkter Kontakt zu den Produzent*innen, und da der Zwischenhandel bzw. Supermarkt umgangen wird, kommt dort mehr vom Erlös an.
Die Lebensmittel werden an einem geeigneten Ort oder gleich in einem Ladengeschäft gelagert und die Mitglieder können zu festgelegten Zeiten hier „einkaufen“ und übernehmen auch Dienste wie Abrechnung oder Putzen.
März
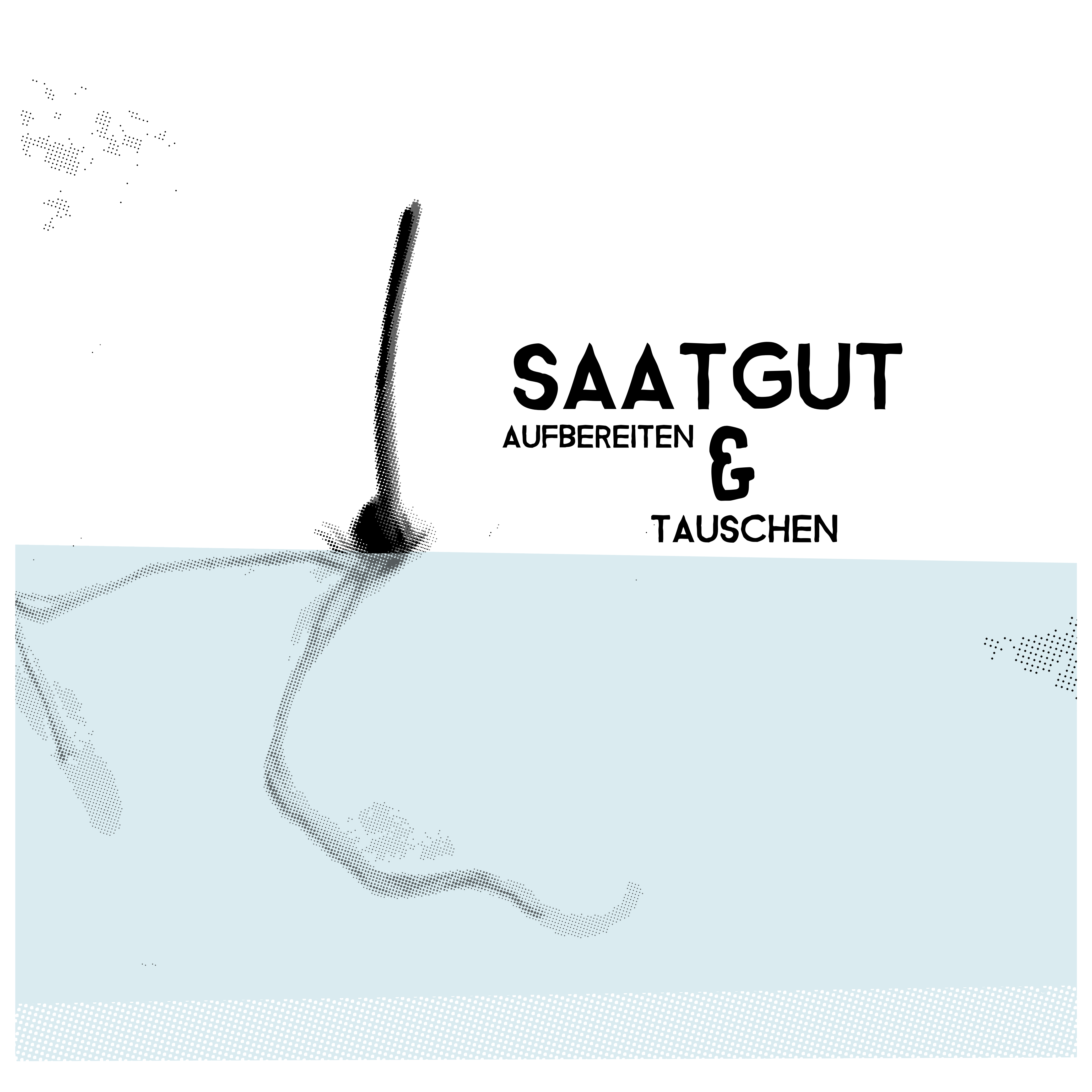
Saatgut aufbereiten und tauschen
Der Frühling ist fast da und im Garten sprießen schon die Krokusse und die Osterglocken. Zeit, sich zu überlegen, welches Saatgut vielleicht noch fehlt für die Aussaat auf dem Balkon, im Beet oder im Schrebergarten.
Aber im März findet ihr auch noch an vielen Orten Saatgutfestivals, auf denen ihr euer eigenes Saatgut tauschen könnt.
Am besten tauscht ihr samenfestes Saatgut, dann könnt ihr euch sicher sein, dass die Pflänzchen auch in dieser Saison die gewünschten Eigenschaften entwickeln. Bei Hybriden weiß man das nie so genau. Anmerkung: wenn nicht anders vermerkt, sind alle Saatguttütchen, Saatbänder etc, die ihr im Baumarkt findet, Hybriden. Warum samenfestes Saatgut super ist, haben wir für die vergangene Kampagne „Konzernmacht begrenzen“ nochmal zusammengefasst.
Damit ihr eure selbst gesammelten und getrockneten Samen aus dem vergangen Jahr gut beschriften und mitnehmen könnte auf die nächste Saatguttauschbörse, haben wir für euch eine Vorlage gemacht. Einfach ausdrucken, schneiden, falten, mitnehmen.
Auf der Suche nach Orten, die sich zum Tauschen eignen, sind viele Aktive kreativ geworden. In einem Nachbarviertel wird der Bücherschrank genutzt, um Saatgut zu tauschen. Mit einer Box, in der Gärtner*innen ihr beschriftetes Saatgut legen, geht das ganz einfach.
Einblicke vom politischen Marktfrühstück im Neuen Frankfurter Garten
Im Neuen Frankfurter Garten kamen im März 2019 Landwirte, Verbraucherinnen und Initiativen zusammen um über die Zukunft der regionalen Versorgung zu diskutieren.





Einblicke vom politischen Marktimbiss auf dem Stadt.Land.Markt in Bonn
Aktion Agrar und Stadt.Land.Markt diskutierten auf dem politischen Marktimbiss in Bonn über die Herausforderung für Regionale Ernährung im Rheinland.





April

Jungpflanzen tauschen, Saatgut bestellen – Lebensmittel selbst anbauen
Auch wenn das Wetter den Frühling noch nicht direkt erahnen lässt: jetzt ist eine super Zeit, um noch Pflänzchen am Fenster vorzuziehen!
Wir empfehlen dafür Saatgut, dass „samenfest“ ist. Wenn du einen Kürbis ziehst aus samenfestem Saatgut, kannst du im Herbst die Kürbiskerne aus dem Fruchtfleisch pulen, waschen und trocknen: und dann wieder auspflanzen.
Das geht bei Hybridsaatgut nicht – und leider ist vieles, was du so im Bau- oder Supermarkt findest, Hybridsaatgut (s. Exkurs). Empfehlenswert ist deshalb die Bestellung bei kleineren Saatgutintiativen und regionalen Bio-Züchtern. Neben den Saatgutkatalogen von Bingenheimer Saatgut oder Dreschflegel lohnt sich unbedingt auch die Recherche nach lokalen Anbietern.
Mit dem Vorziehen von einigen Pflanzen kannst du direkt beginnen, wie z.B. bei Tomaten und Kürbissen. Als Behälter eignen sich alte Papierrollen, Eierkartons oder Töpfchen aus Zeitungspapier (s. Foto). Andere Pflanzen können direkt nach draußen, wie die kälteresistente Ackerbohne. Erbsen z.B. können ab Anfang April direkt ins Freiland gesetzt werden.
An vielen Orten und in viele Städten tauschen Menschen Saatgut aus ihren Gärten oder von ihren Balkonen. Du kannst dort eigenes Saatgut mitbringen, meistens kommen aber Menschen, die ihr Saatgut verkaufen wollen, wie zum Beispiel die Lila Tomate oder die Regenbogenschmiede. Hier kannst Du alte Sorten kaufen, die nicht mehr auf dem Markt sind. Viele Börsen bieten auch Jungpflanzen zum Verkauf an.
Alle Termine findest du hier:
Wann können die Pflanzen raus?
Bis zu den Eisheiligen Mitte Mai müssen die kleinen Pflänzchen auf jeden Fall noch drin bleiben. Erst danach ist die Gefahr, dass es nochmal richtig Bodenfrost gibt, so gering, dass die Pflanzen es auch nach draußen schaffen.
Wie ist das eigentlich mit Hybriden?
Bei Hybriden gibt es sogenannten „Elternlinien“, die über mehrere Gemüsegenerationen hinweg „reinerbig“ gemacht wurden. Heißt konkret: die Pflanzen hat über erzwungene Selbstbefruchtung über mehrere Jahre hinweg bestimmte Eigenschaften entwickelt, die sie weiter geben kann, wie eine schöne Fruchtfarbe oder Resistenz gegenüber Pilzbefall.
Durch die Kreuzung zweier solcher „Inzuchtlinien“ gewinnt man Hybridsaatgut. Wird es ausgebracht, wachsen Pflanzen, die die gewünschten Eigenschaften von beiden Elternlinien zeigen, also zum Beispiel eine Tomate, die schön gelb ist und resistent gegen Braunfäule.
Doch schon in der nächsten Generation, also bei den Samen dieser Hybridpflanzen, verlieren sich die Eigenschaften wieder.

Einwegsamen
Sie sind deshalb nicht für eine Nachzüchtung auf eigene Faust oder Wiederaussaat geeignet: Einwegpflanzen. Für Landwirt*innen heißt das: sie müssen jedes Jahr neues Saatgut kaufen. Die meisten akzeptieren diese Kosten, denn das Hybridsaatgut verspricht gute Erträge und auf die sind sie angewiesen. Eigene Saatgutgewinnung und die Jungpflanzenanzucht bringen viel Arbeit mit sich. Diese können auch nicht alle Betrieben leisten.
Gleichzeitig erhöht sich so die Abhängigkeit der Betriebe von Saatgutfirmen und -konzernen, wie Bayer, Monsanto oder Syngenta. Diese nehmen sowohl darauf Einfluss, welche Sorten gezüchtet werden als auch auf die Preise.
Einblicke vom politischen Marktfrühstück am 14. April in Berlin
Das erste politische Marktfrühstück zum „Jahr der Alternativen“ von Aktion Agrar auf dem Regionalmarkt „Die Dicke Linda“ in Neukölln. Fotos: E. Schumann






Fotos: E. Schumann
Mai
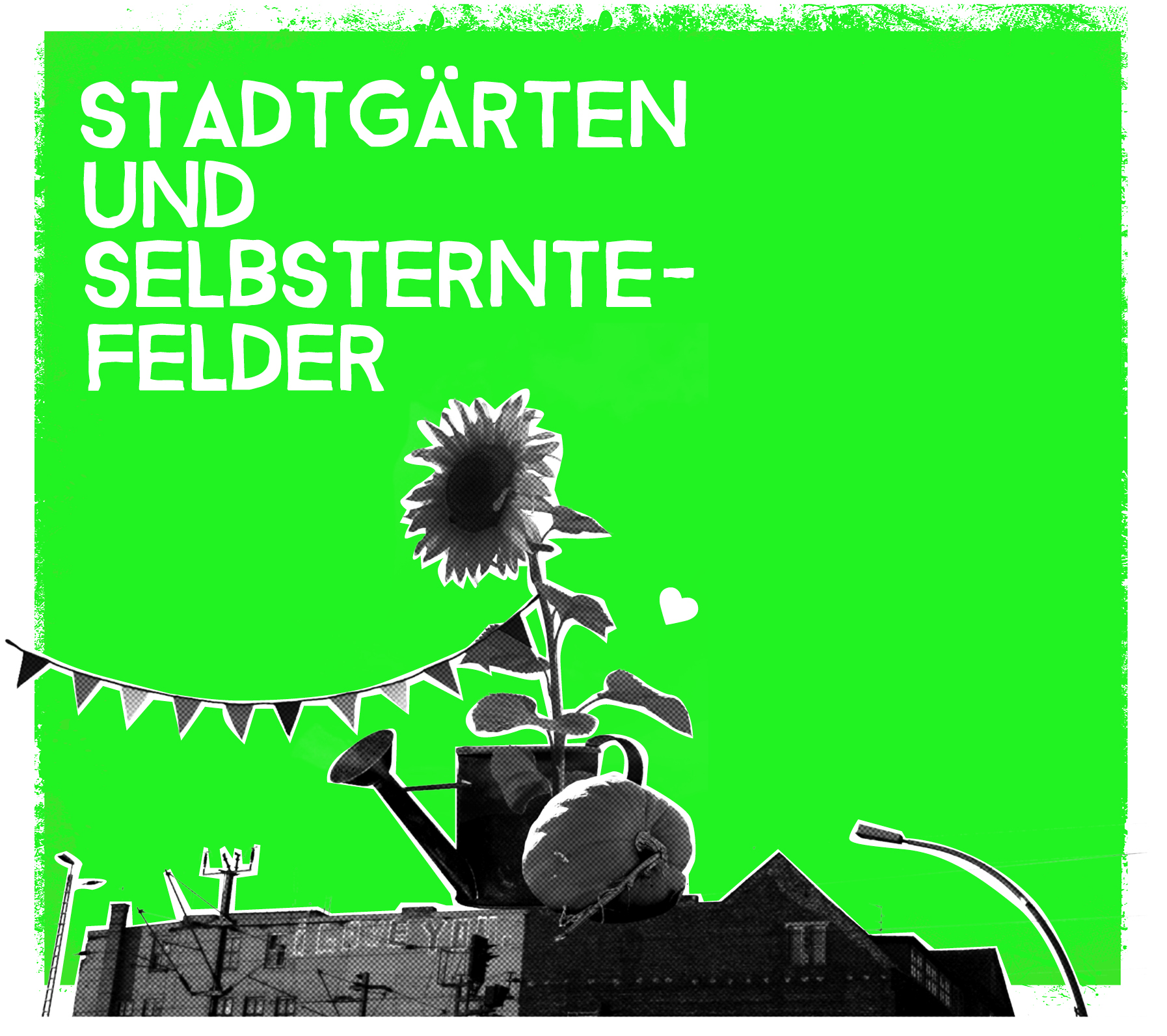
Lebensmittel selbst anbauen: Urbanes Gärtnern und Selbsterntefelder
Spätestens jetzt blüht so Einiges da draußen. Das ertauschte und angesäte Saatgut, die kleinen Tomaten oder Bohnen dürfen jetzt bald ins Freie. Doch wohin, wenn mensch weder Balkon noch Garten hat und mitten in der Stadt lebt?
Lass dich und deine Saat nicht unterkriegen! Es gibt viele Stadtgarten-Initiativen, Selbsterntefelder oder Bauerngärten am Stadtrand, wo du dir einen kleines Stück Acker mit Freund*innen anmieten kannst.
urban gardening / Stadtgarten – so funktioniert’s:
Urbane Gärten, ob mit Blumen oder Gemüse, entstehen meistens auf verlassenen oder ungenutzten Flächen (oder auch Dächern) in Städten. Gruppen, Initiativen oder Vereine beginnen die Flächen, mit (oft nur befristeter) Duldung der Gemeinde, zu bepflanzen und schaffen so Orte der Begegnung und des Rückzugs ins Grüne. Die Vielfalt der dort angebauten Sorten ist meist erstaunlich – genauso wie die Kreativität der Behältnisse und der Anbaumethoden: Da viele Urbane Gärten keine dauerhafte Bleibe garantiert bekommen, pflanzen sie ihr Gemüse und Kräuter in Säcke, Brotkisten oder Tetrapaks – um, wenn es hart auf hart kommt, umziehen zu können.

Exkurs: Guerilla Gardening – so funktioniert’s:
Manchmal wird auch ungefragt, dann aber auf kleineren Flächen in der Stadt gepflanzt, z.B. in Blumenbeeten vor öffentlichen Gebäuden, in Parks, am Straßenrand oder auf Blumeninseln. Dafür braucht es schnelle Hau-Ruck-Aktionen, nach denen erkennbar ist: Hier wächst etwas schönes. Das A und O dabei: Toleranz, im besten Fall Unterstützung der Nachbarschaft, sonst geht’s schnell wieder kaputt.
Selbsterntefelder – so funktioniert’s:
Selbsterntefelder, oder auch Mietgärten genannt, sind Äcker, oft an Stadträndern gelegen, die in kleine Parzellen eingeteilt sind. Sie werden an Einzelpersonen oder kleine Gruppen pro Saison vermietet. Meistens an landwirtschaftliche Betriebe gekoppelt, werden die Selbsterntefelder vorbereitet (teilweise sogar schon bepflanzt) bevor die Saison losgeht und genießen ein gewisses Maß an Infrastruktur zum Gärtnern (Werkzeug, Wasser, Kompost). Rat und Unterstützung beim Gärtnern bieten die Landwirt*innen und die Gemeinschaft der Garten-Nachbar*innen.
Im Internet finden sich eine Vielzahl an Plattformen und Initiativen, die mehrere Standorte abdecken. Z.B. Ackerhelden.de oder meine-ernte.de. Die Chance, dass du in deiner Gegend ein Stück Acker findest, steht also gar nicht schlecht.

Das erzählen Hans und Anna-Lena aus Köln von ihrem Selbsterntefeld:
Für Großstädter bleibt der Wunsch nach selbst angebauten Bio – Karöttchen oft nur ein Traum. Auf unseren Balkon passt nicht mehr als einTopf mit Basilikum, die Hinterhöfe sind schattig und die Wartelisten für Kleingärten in Köln enorm lang. Die Suche nach einer Möglichkeit dennoch nicht auf einen Garten und selbst angebautes biologisches Gemüse verzichten zu müssen, brachte uns vor 5 Jahren zu dem Konzept der Selbsterntegärten.
Den Selbsterntegarten in Köln bepflanzt der Landwirt im Frühjahr mit einer Vielfalt an Gemüsesorten, Kräutern und Blumen in langen Reihen nebeneinander. Diese Reihen werden später quer unterteilt, wodurch einzelne Parzellen entstehen, die alle das gleiche Angebot an Gemüse umfassen. Ab Mai können die bereits bepflanzten Parzellen gegen einen Saisonbeitrag vom Landwirt übernommen werden. Ist eine Gemüsereihe bereits im Juni abgeerntet, können an dieser Stelle neue Jungpflanzen gesetzt werden. Jede*r kann hier bis in den Spätherbst gärtnern, auch ohne Erfahrung. Die Landwirte stellen Gartengeräte, Wasser und vor allem reichlich Informationen rund um das Geschehen im Garten zur Verfügung.
Wir genießen es sehr im Sommer ein bis zwei Mal in der Woche in den Garten zu fahren, zu beobachten, wie sich der Garten entwickelt hat und vor allem leckeres Gemüse zu ernten. Durch die gute Vorbereitung der Landwirte ist der Aufwand gering. Es muss zwar Unkraut gejätet werden, aber es entfällt die schwere Bodenbearbeitung am Anfang der Saison. Bei den Besuchen im Garten treffen wir meistens auch auf Nachbarn, tauschen uns mit diesen aus und erhalten den ein oder anderen Tipp. Wer in den Urlaub fährt, findet sicherlich jemanden, der*die mit auf den Garten schaut. Die Landwirte bringen im Herbst eine Gründüngung auf dem Feld aus und bereiten so die Fläche optimal für das neue Gartenjahr vor. Deshalb können auf der Gartenfläche auch nur einjährige Kulturen gepflanzt und keine mehrjährige Pflanzen wie z.B. Beerensträucher angebaut werden.
Für uns ist das Konzept super, denn es lässt es sich mit unseren Stadt- und Arbeitsleben vereinen und bietet die Möglichkeit biologisch zu gärtnern.
Juni

Regionale Lebensmittel: Bauernmärkte und Marktschwärmer
Der Sommer naht! Noch gibt‘s Spargel und Erdbeeren. Aber auch die ersten Sommerfrüchte können schon geerntet werden. Und das Wetter macht nun auch endlich Lust darauf, draußen zu sein. Worauf also noch warten? Eine Fahrradtour zum Bauernmarkt in eurer Nähe wäre doch eine gute Gelegenheit, sich aus dem saisonalen Obst- und Gemüseangebot das Beste für ein leckeres Abendessen herauszusuchen und direkt mit den Erzeuger*innen ins Gespräch zu kommen. So wisst ihr genau, wo die Heidelbeeren oder die Eier herkommen, die ihr für euren Kuchen am Wochenende noch benötigt, und könnt dazu beitragen, dass das, was ihr bezahlt, auch tatsächlich bei den Bäuer*innen ankommt.
Vom Handelsriesen oder lokal vom Bauernmarkt?
Heute wird der deutsche Lebensmittelhandel maßgeblich von fünf Supermarktketten beherrscht. 90 Prozent des Marktes teilen die Handelsriesen Edeka, Rewe, Aldi, Lidl und Metro unter sich auf. Dabei gerät völlig in Vergessenheit, wie der tägliche Bedarf der Städter*innen vor der Gründung von Aldi und Co. gedeckt wurde. Nämlich fast ausschließlich über Bauernmärkte, auf denen die Bäuer*innenfamilien des Umlands das feilboten, was gerade von den Feldern kam. In Zeiten, in denen fünf Konzerne 90% des Lebensmitteleinzelhandels kontrollieren, ist es geradezu ein politisches Statement, auf dem Bauernmarkt zu kaufen, um so die ursprüngliche, direkte Form von Vermarktung mit kurzen Lieferketten und dem direkten Kontakt von Stadt und Land zu fördern. Weil regional und saisonal Erzeuger*innen stärkt und zudem noch super schmeckt!
Wer nicht weiß, wann und wo der nächstgelegene Wochenmarkt stattfindet, findet Infos dazu im Internet unter dem Stichwort „Wochenmarkt“ und der jeweiligen Region, oder ihr fragt in eurer Nachbar*innenschaft – vielleicht ergeben sich so sogar neue Kontakte und ihr bringt euch demnächst gegenseitig etwas von eurem neuen Lieblingsmarktstand mit.
Wem die Zeit oder Muße fürs Schlendern und Aussuchen auf dem Markt selbst fehlt, der*die kann die gewünschten regionalen Produkte auch online bestellen und einmal die Woche auf einem Markt der Initiative „Marktschwärmer“ abholen. „Marktschwärmer“ (früher food assembly) genannt, gibt es inzwischen in etlichen Städten.
Und noch ein Tipp: Eine Übersicht über die Obst- und Gemüsesorten, die erade erntefreif sind, findet Ihr unter regional-saisonal.de/saisonkalender. Hier gibt’s auch leckere saisonale Rezepte und Kochideen.
Juli

Solidarische Landwirtschaft
Agrarwende selber machen
Du möchtest gerne dein eigenes Gemüse essen, aber dir fehlt der Garten oder du traust dir das Anbauen nicht so recht zu? Dann schließe dich doch einer Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) in deiner Nähe an und du kannst dir deinen Gemüseanteil regelmäßig von deiner Verteilerstelle abholen.
Wie werden Gemüsesorten und tierische Produkte entschieden?
Einige Solawis bieten ihren Mitgliedern neben Möhren, Kartoffeln, Pastinaken und co. auch Obst, Eier, Käse und Fleisch an. Jedes Jahr erstellen sie einen Anbauplan, an dem sich alle Ernteteiler*innen beteiligen können. Da mit einer errechneten Erntemenge kalkuliert werden kann, werden Überproduktionen und Abfälle von Lebensmittel vermieden.
Was sind die Vorteile des regionalen Gemüses?
Das maßlose Überangebot der Supermärkte ersetzen sie hier durch meist unbekannte, an heimische Bedingungen angepasste Sorten. Nebenbei lernst du neue frische Lebensmittel kennen, die dir in der Supermarktwelt nie begegnet wären, da sie oftmals verarbeitungs-, transport- und lagerungsungünstige Eigenschaften aufweisen oder über zu geringe Ernteerträge verfügen dass sie somit als Massenware überflüssig macht.
Was bedeutet solidarisch?
Die direkte Kooperation von Landwirt*in und Verbrauchergemeinschaft trägt gemeinsam das Risiko und die Verantwortung der Lebensmittel von der Aussaat bis zur Ernte. Die Mitglieder stellen die finanzielle Unterstützung bereit, indem sie die gemeinschaftlichen Kosten entweder durch einen anteiligen Standardbetrag teilen oder nach dem solidarischen Prinzip „jeder gibt, was er kann“ zusammenlegen. Dadurch ist die Existenz der Landwirte nicht von Dumpingpreisen des Lebensmittelhandels oder Ernteausfällen bedroht und es können auch in Zukunft weiterhin Bio- Lebensmittel in deiner Region angebaut werden. Dadurch, dass deine Lebensmittel nun nicht mehr aus aller Welt herangekarrt werden müssen, trägst du zusätzlich enorm zur Reduktion der Klimagasemissionen bei.
Was ist der Unterschied zur Abo-Kiste?
Um einen direkten Bezug zur Produktion deiner Lebensmittel zu bekommen, kannst du durch Arbeitseinsätze mit Gleichgesinnten mehr über die ökologische Landwirtschaft erfahren. Der Unterschied zur Abokiste ist der, dass bei Solawi nicht die Produkte, sondern die gesamte Produktion vom Saatkorn bis zum reifen Salat durch die Gemeinschaft finanziert wird und somit die Landwirte absichert. Na, dass macht doch Mut für die Agrarwende!
August

Mundraub, Einkochen, Fermentieren
Pflücken und Naschen
Beeren, Kirschen, Mirabellen, Zwetschgen, Pflaumen, … Man weiß gar nicht, wo man hinschauen und was zuerst probieren soll. Bei einem Spaziergang in den Feldern lässt es sich im Moment so richtig satt werden. Von Baum und Strauch direkt in den Mund, frischer geht‘s nicht. Und wenn jede*r nur so viel nimmt, wie es gerade dem eigenen Bedarf entspricht und verantwortungsvoll mit der Natur umgeht, ist genug für alle da! Unter mundraub.org findet ihr essbare Landschaften in eurer Umgebung und Gruppen, die sich in der Pflege und Nachpflanzung der Obstbäume engagieren. Wenn ihr selbst eine solche (eigentumsfreie) essbare Landschaft kennt oder neu entdeckt, könnt ihr sie auf der Website von „mundraub“ in die Karte eintragen und eine kurze Beschreibung beifügen.
Lebensmittel haltbar machen für den Winter
Und wenn der Magen mal voll ist, der Urlaub naht, und das viele Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten, vom Markt oder aus der Biokiste trotzdem so verlockend duftet? Dann kann man einkochen oder fermentieren – ganz wie früher. Reizt es doch, an Weihnachten zum selbstgemachten Zimtparfait ein Glas eingemachte Zwetschgen auf den Tisch zu stellen, oder zum Kartoffelsalat fermentierte Gurken reichen zu können.
Was ist der Vorteil vom Fermentieren?
Das Besondere beim Fermentieren ist, dass das Gemüse dabei nicht gekocht wird und so alle Nährstoffe erhalten bleiben. Außerdem sind die enthaltenen Milchsäurebakterien super für die Darmflora! Klimafreundlich ist die Methode auch, denn ihr braucht keinen Strom und auch sonst keine besonderen Zutaten. Besonders gut lassen sich „härtere“ Gemüse wie Kohl, Möhren oder Paprika fermentieren, weichere Sorten wie Tomaten werden schnell „matschig“, schmecken aber auch.
Fermentieren – Wie geht das?
Zuerst wird das Gemüse gewaschen und in kleine Stücke geschnitten oder gehobelt. Danach gebt ihr alles mit unbehandeltem Salz zusammen in eine große Schüssel und presst den Saft so gut es geht heraus. Wenn das Gemüse nicht genug Flüssigkeit abgibt, wie das z.B. bei Roter Bete der Fall ist, bereitet ihr eine 2-4%ige Salzlösung zu.
Das Gemüse schichtet ihr mit Gewürzen zusammen in Bügelgläser oder Gläser mit Twist-off Deckeln, den ihr nicht fest zudreht. Mit Salzlake begießen und mit einem Stein oder einem kleinen Glas beschweren, damit sich das Gemüse immer unter der Wasseroberfläche befindet, sonst fängt es leicht an zu schimmeln. Einen Teller unter das Glas stellen, denn sobald die Fermentation anläuft, fängt es im Glas an zu blubbern. Das ist ein gutes Zeichen! Je nach Gemüse dauert der Femerntationsprozess 5 Tage bis 4 Wochen bei Zimmertemperatur. Danach stellt ihr die Gläser in einen kühlen Keller oder in den Kühlschrank. So halten sie sich mindestens ein Jahr.
Und wie geht das Einkochen?
Beim Einkochen hingegen wird das Obst oder Gemüse erhitzt, um zu verhindern, dass die Früchte gären. Zuerst könnt ihr das Obst oder Gemüse waschen, schneiden und in Gläser füllen, die ihr dann verschlossen in einen Einkochtopf stellt. Nun füllt Ihr den Topf mit Wasser und erhitzt es langsam. Die Wassertemperatur und Länge des Einkochens variiert dabei je nachdem, was Ihr einwecken möchtet. Danach nehmt Ihr die Gläser heraus und lasst sie abkühlen. Am besten kommen dann noch kleine Schildchen drauf, damit man später noch weiß, ob man sich nun auf ein Glas Pflaumen- oder Erdbeermarmelade freuen darf.
Tipps und eine genaue Anleitung zum Einkochen und Fermentieren findet ihr zum Beispiel auch hier:
September

Abo-Kisten mit regionalem und krummem Gemüse
Eine fertig gepackte Kiste mit frischen Lebensmitteln direkt vom Hof in deine Küche – eine naive Vorstellung von der eher intransparenten Lebensmittelproduktion oder doch möglich? Wer nicht länger den Spargel aus China und den Salat aus Spanien kaufen möchte und eine nachhaltige Landwirtschaft fordert, kann sich jede Woche eine Biokiste nach Hause liefern lassen.
Was sind die Vorteile von Biokisten?
So eine individuell zusammengestellte Lieferung bringt viele Vorteile mit sich. Der Supermarktbesuch wird dir erspaart. Du lernst neue Gemüsesorten kennen und kannst somit neue Rezeptideen probieren. Die Garantie für frische, saisonale und somit besonders vitaminreiche Produkte versteht sich bei diesem Angebot von selbst. Außerdem kannst du dir deine Lebensmittel für deine Abo-Kiste meist selbst zusammenstellen, so dass du Gemüse nach deinem Geschmack bekommst. Dementsprechend hast du zum Beispiel die Wahl zwischen verschiedenen Optionen wie „Kinderkiste“, „Stillkiste“, „vegetarischen Kiste“ oder „veganen Kiste“ – und das noch in verschiedenen Größen. Falls dir eine ganze Abo-Kiste dennoch zuviel sein sollte, kannst du dir diese auch mit Freunden oder Nachbarn teilen.
Das Allerbeste daran ist natürlich, dass du genau weißt, woher deine Lebensmittel kommen und was für eine Art der Landwirtschaft du damit unterstützt – nämlich eine, die den direkten Kontakt zwischen Produzent und Konsument aufleben lässt.
So wirst du zum Lebensmittelretter!
Neben der regionalen Lebensmittelwirtschaft förderst du mit deiner Biokiste noch etwas ganz Wichtiges – in unseren Supermärkten landet längst nicht das komplette geerntete Obst und Gemüse. Genauer gesagt landet ein Großteil in der Tonne oder bleibt auf dem Acker – und zwar aus optischen Gründen! Bevor die geernteten Obst- und Gemüsearten in den Handel kommen, werden sie nach bestimmten Schönheitskriterien aussortiert.
Um sich diesem Irrsinn zu widersetzen ist die deutschlandweite Biokiste „Etepetete“ nachgegangen. Demzufolge werden über die Internetseite etepetete-bio.de/boxen/?np=Retterboxen sogenannte „Retterboxen“ in Bioqualität angeboten. Diese enthalten Obst und Gemüse, welches dem Landwirt aufgrund „individueller Formen“ vom Einzelhandel nicht abgenommen wird.
Oktober

Stoppelparty: gemeinsam nachernten und feiern
Gute Kartoffeln werden einfach untergepflügt?
Wenn die Erntemaschine über den Kartoffelacker gerollt ist, bleibt da noch jede Menge liegen… die Bilder von kleinen Gruppen, Familien und Verwandten, die gemeinsam über die Felder laufen und nachernten, sind noch gar nicht so alt. Zu unserem Alltag gehören sie aber nicht mehr.
Stattdessen wird alles, was liegen bleibt, beim nächsten Durchgang einfach untergepflügt. Das ist zwar billiger, aber gleichzeitig auch eine riesige Verschwendung von noch essbaren Feldfrüchten.
Das wollen wir ändern! Die Stoppelparty
Bei einer Stoppelparty wird gemeinsam gesammelt, was auf den Feldern noch liegt, ob Kartoffeln, Möhren oder Zwiebeln, Kürbisse oder Pastinake. Und dann kochen alle Beteiligten daraus in der Feldküche ein leckeres Essen. Vielleicht verbunden mit einem kleinen Input von der Besitzer*in des Hofes, die über die Herausforderungen regionaler Vermarktung spricht, oder einer Vertreter*in einer Initiative in der Nähe, die sich zum Ziel gesetzt hat, Produzent*innen und Konsument*innen in der Region besser zu vernetzen.
Denn nach einem gemeinsamen Nachmittag auf dem Feld haben a) alle Hunger und wissen b) regionale Produkte auch gleich ganz anders zu schätzen. Wer nicht aufwändig kochen möchte, kann – mit Erlaubnis – ein Kartoffelfeuer machen oder das Geerntete mit zu einer anderen Veranstaltung nehmen: hier empfehlen wir die „Schnippeldisko“. Auch dafür muss das Gemüse ja irgendwo herkommen 🙂
Bei mir gibt es keine Stoppelparty. Was kann ich sonst tun?
Stoppeln geht natürlich auch mit weniger Aufwand und wesentlich spontaner. Frag doch einfach bei einem Hof in deiner Nähe an, ob du an einem Wochenende vorbeikommen kannst. Dann packst du Freund*innen und Kind und Kegel ein, schnappst dir Körbe und Taschen und dann geht es ab auf den Acker!
Einblicke von unserer Stoppelparty
Als Teil der Jahr der Alternativen feiern Aktion Agrar und Shout Out Loud auf dem Dottenfelder Hof eine Stoppelparty. Nachernten, kochen, feiern.






Willst du selbst eine Stoppelparty veranstalten? Das geht ganz einfach, wenn Du ein paar Dinge beachtest:
- Such dir Verbündete. Eine Stoppelparty ganz alleine zu organisieren macht nicht so viel Spaß. Vielleicht gibt es eine lokale Gruppe von Foodsharing, über Solawi bis Slowfood, die dich unterstützt?
- Sprich ein paar Höfe in der Umgebung an. Vielleicht kennen die das Format noch „von früher“, vielleicht sind sie auch erstmal skeptisch. Die meisten haben aber nichts dagegen, immerhin würden sie die Kartoffeln, Möhren& Co eh nicht mehr ernten, weil es sich nicht lohnt – finanziell gesehen.
- Am einfachsten ist es, vor Ort ein Feuer zu machen und jede*r bringt was mit. Kartoffeln mit Quark oder anderen Dips bieten sich an, auch Stockbrot geht immer.
- Wenn du eine Person kennst, die das nötige Equipment für eine Feldküche besitzt, umso besser! Manchmal hat sowas auch die lokale Feuerwehr oder ein Jugendverein. Wenn du noch nie mit Gas gekocht hast, dann frage am besten eine Person, die damit Erfahrung hat.
- Ein bisschen Infrastruktur braucht es. Du musst wissen: wo gibt es Wasser? Wo ist die nächste Toilette? (Vielleicht auf dem Hof?) und wie kommen die Menschen zum Acker?
Manchmal bietet sich ein Shuttle-Service an, wenn eine Person bereit ist, das zu übernehmen. Manche Höfe liegen aber auch einfach so nah an Zugtrassen oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, das es auch ein Hinweis auf die nächste Bushaltestelle tut. - Brauchst du eine schriftliche Einladung, Handzettel oder tut es ein Hinweis per Mail?
Erstmal mit einer kleinen Gruppe anzufangen und das Format zu erproben, kann sinnvoll sein, wenn alle den nötigen „Pioniergeist“ mitbringen. - Eine Schlechtwetter-Option festlegen und einen Ausweichtermin vereinbaren: wenn es im Oktober wirklich schüttet und schon sehr kalt sein sollte, macht das Sinn.
- Bei gutem Wetter: das Buddeln in der Erde genießen und staunen, was auf einem „abgeernteten“ Acker noch so alles rumliegt!
November

Lebensmittel retten & teilen
Was passiert mit den Lebensmitteln, die kurz vor Ladenschluss nicht verkauft wurden? Mit dem Brot, das die Bäckerei noch um 18.00 aufbackt, mit den Bananen, die leichte Druckstellen haben? Oft entsorgen Supermärkte diese Lebensmittel, weil sie nicht mehr schön genug aussehen oder nicht lange genug frisch und knackig bleiben.
Weltweit werden jedes Jahr 4 Milliarden Tonnen Lebensmitteln produziert. Davon gehen über 1,3 Milliarden Tonnen verloren, bleiben auf dem Acker liegen oder landen in der Tonne. Wenn Lebensmittelverschwendung ein Land wäre, stünde es direkt hinter den USA und China auf der Liste der Länder, die die meisten Treibhausgase produzieren.
Wir finden: Lebensmittel gehören auf den Teller und nicht in die Tonne!
Wie das Thema in die Öffentlichkeit rückte..
2011 drehte Valentin Thurn den Film „Taste The Waste“ und brachte das Thema Lebensmittelverschwendung in die deutsche Öffentlichkeit. 2012 wurde in Anlehnung daran der foodsharing e.V. gegründet, welcher das Teilen von Essenskörben ermöglichte, und durch den u.a. die „Genießt Uns!“-Kampagne entstanden ist.
Aktion Agrar hat dann 2015 mit der Kampagne „Leere Tonne“ dazu beigetragen, dass die Diskussion um die Vermeidung von Lebensmittelabfällen auch an Politiker*innen herangetragen wurde. Gemeinsam mit der Slow Food Youth und den Aktiven von Foodsharing forderten wir den Wegwerfstopp für Supermärkte, wie es ihn in Frankreich gibt.
Du willst aktiv werden gegen Lebensmittelverschwendung?
Deutschlandweit ist die größte Plattform gegen Lebensmittelverschwendung foodsharing. Das ist eine Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, seit 2012 Lebensmittel von Lebensmittelbetrieben aller Art zu retten und das Bewusstsein für das Thema zu stärken.
Etwa 42.000 foodsaver retten bereits regelmäßig bei Bioläden, Bäckereien, Getränkehändlern, Restaurants, Kantinen, Markständen, Händlern, Supermärkten und vielen anderen Betrieben. Insgesamt wurden so bis zum Herbst 2018 nach Angaben von foodsharing über 17 Millionen Kg Lebensmittel vor der Vernichtung bewahrt. Ihr wollt mitrettern? Findet eure lokale Gruppe und schaut euch in Ruhe das foodsharing-Wiki an, dann besteht ihr auch das Foodsharing-Quiz 🙂
Und was wir sonst noch tun können? Lebensmittel kaufen, auch wenn sie kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum stehen, Obst und Gemüse auch dann noch mitnehmen, wenn es nicht mehr makellos, aber immer noch lecker ist. Bei Betrieben einkaufen, die den foodsharing-Sticker haben und keine Lebensmittel mehr wegwerfen. In der Lieblingsbäckerei fragen, was sie mit dem alten Brot machen. Das wird oft noch an Tiere verfüttert und teilweise auch zur Energiegewinnung verbrannt.
Falls ihr sie noch nicht kennt, schaut euch mal die Seite „Zu gut für die Tonne“ an, hier gibt es Tipps, wie ihr Lebensmittelverschwendung vermeiden könnt, eine Rezeptedatenbanken für kreative Kochideen mit Resten und auch eine App dazu.
Das Ganze gibt es auch für die Gastronomie, falls ihr die App „Too good to go“ mal probieren wollt.
Wir freuen uns über eure Erfahrungsberichte an alternativen@aktion-agrar.de
Dezember

Weltläden – fair gehandelte Lebensmittel
Die kalte Jahreszeit macht es schwer, ausschließlich auf regionale Produkte zu setzen. Auch, wer regelmäßig auf dem Wochenmarkt in der Nähe einkauft, wärmt sich danach vermutlich mit einer heißen Tasse Kaffee oder Tee zuhause auf. Das sind Lebensmittel, die in weit entfernten Ländern produziert und per Schiff, Lastwagen oder Flugzeug nach Deutschland importiert werden.
Alternativbewegung für fairen Handel
Wir setzen uns für Direktvermarktung und eine solidarische Landwende ein. Dahin führen kurze Lieferketten, um die Erzeuger*innen in möglichst hohem Maße am Gewinn zu beteiligen. Genau das wird bei Importen in großem Ausmaß missachtet: Häufig sind die Erlöse für solche Produkte viel zu niedrig, als dass Erzeuger*innen und Arbeiter*innen im Globalen Süden davon gut leben können. Zusätzlich verschlimmern hohe Importzölle der Europäischen Union, der Machtmissbrauch multinationaler Konzerne sowie die permanente Missachtung sozialer und ökologischer Standards die Situation für die Kleinproduzent*innen vor Ort.
In den 1970er Jahren ist eine Alternativbewegung entstanden, die mit politischen Aktionen und Bildungsarbeit gegen die unterdrückenden globalen Handelsstrukturen opponiert, und Importgüter wie Kaffee oder Tee zu fairen Preisen verkauft. Um sicherzustellen, dass in solchen Weltläden tatsächlich ausschließlich fair gehandelte Produkte zu kaufen sind, wurden beispielsweise Kriterien für Importeur*innen und neue Projekte mit Kleinproduzent*innen im Globalen Süden entwickelt.
Im Kleinen Anfangen
Der Einsatz für mehr Gerechtigkeit im internationalen Welthandel beginnt im ganz Kleinen – z. B. damit, dass wir beim nächsten Mal, wenn die Kaffeebohnen alle sind, darauf achten, für fair gehandelten Nachschub zu sorgen. Und wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten ist, kann im Weltladen ebenfalls fündig werden – häufig werden dort auch fair gehandelte Textilien und Kunsthandwerk feilgeboten.
Kommt gut ins neue Jahr!
Kalender der Alternativen
Die Agrar- und Ernährungswende geschieht auf den Höfen und Küchen, auf dem Land und im Stadtviertel. Lasst uns gemeinsam den Großkonzernen zwischen Acker und Teller die kalte Schulter zeigen. Während immer mehr Menschen alles nur noch online bestellen – vom Schnürsenkel bis zur Aubergine – sich das Essen von tendenziell unterbezahlten Lieferant:innen vor die Tür […]
Aktuelle Materialien
In unserem Büro warten zahlreiche liebevoll erarbeitete Materialien darauf, dich und viele weitere Menschen zu erreichen. Werde jetzt aktiv: Du kannst uns dabei helfen, die Infos zu verbreiten!
Lasst uns gemeinsam die Geschichten erzählen, die Mut machen: inspirierende Ideen für Alternativen zur industriellen Landwirtschaft verbreiten und so dem Ziel der Agrarwende ein Stückchen immer näher kommen.